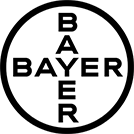IMMUNSYSTEM
Das Immunsystem – wie unser Körper sich verteidigt
Oft wird von der natürlichen Abwehr und dem Immunsystem des Menschen gesprochen. Doch was bedeutet das eigentlich? Das Immunsystem – unsere körpereigene Verteidigungslinie gegen Krankheiten – ist ständig in Alarmbereitschaft, um uns zu schützen, Infektionen zu bekämpfen und den Organismus gegen schädliche Eindringlinge zu verteidigen. Im Dienst der Gesundheit ist das Immunsystem rund um die Uhr im Einsatz. Aber wie schafft es der Körper, Infektionen erfolgreich abzuwehren?
Was ist das Immunsystem? Eine Definition
Das Immunsystem bildet ein komplexes Netzwerk aus einer Vielzahl von Zellen, Organen, Proteinen und chemischen Substanzen. Sie arbeiten koordiniert zusammen, um den Körper vor Infektionen zu schützen. Wenn der Körper einen Fremdkörper wahrnimmt, tritt eine Immunreaktion ein. Sie zielt darauf ab, den Organismus gegen schädliche Erreger zu verteidigen, die Krankheiten und Infektionen auslösen können.
Dabei erfüllt das Immunsystem zwei wichtige Aufgaben. Ein Teil des Systems ist darauf ausgelegt, eingedrungene Fremdstoffe oder Krankheitserreger zu erkennen und diese Information weiterzuleiten. Ein anderer Teil ist dafür zuständig, diese unschädlich zu machen und zu beseitigen.
Wie gut das Immunsystem auf diese Eindringlinge reagieren kann, ist vom allgemeinen Gesundheitszustand sowie dem Lebensstil einer Person abhängig. Eine gesunde Lebensweise, bestehend aus ausgewogener Ernährung, ausreichender Bewegung, gesundem Schlaf und Vermeidung von Stress, kann dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken.

Gegen welche Feinde kämpft das Immunsystem?
Zu den Krankheitserregern, mit denen sich unsere Abwehrkräfte tagtäglich konfrontiert sehen, gehören eine Reihe von Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze. Daneben richtet sich das Immunsystem auch gegen Parasiten und Krebszellen. Bisweilen reagiert das Immunsystem auf bestimmte Substanzen, die mit der Haut in Kontakt kommen, eingeatmet oder über den Mund aufgenommen werden, wie etwa Allergene.
Eine gut funktionierende Immunabwehr kann körpereigene Strukturen von Fremdstoffen, die im Körper nichts zu suchen haben, unterscheiden. Wie macht sie das? Schädliche Elemente erkennt das Immunsystem an den sogenannten Antigenen, das sind Teilstrukturen von Krankheitserregern. Werden solche Antigene erkannt, veranlasst dies das Immunsystem zur Auslösung einer Immunantwort.
Wie bilden sich die natürlichen Abwehrkräfte?
Die Entwicklung unseres Immunsystems beginnt bereits vor der Geburt. In der Schwangerschaft werden Antikörper von der Mutter über die Plazenta auf das Ungeborene übertragen. Sie verleihen dem Kind in seinen ersten Lebensmonaten einen Grundschutz. Diese Immunität ist jedoch noch sehr unausgereift. Babys sind daher anfällig für Infektionen, insbesondere, wenn es sich um Frühgeborene handelt, bei denen die Übertragung mütterlicher Antikörper zu früh unterbrochen wurde.
Während der Geburt kommt das Baby, das sich zuvor in einer geschützten Umgebung befand, mit vielen Mikroorganismen der Mutter in Kontakt, darunter auch mit bestimmten Bakterien, die zur Entwicklung seiner Darmflora beitragen.
Danach profitieren Stillkinder von Antikörpern, die über die Muttermilch in ihren Organismus gelangen. Die von der Mutter in der Schwangerschaft und während der Stillzeit übertragenen Antikörper werden vom Organismus des Kindes mit der Zeit abgebaut. Doch das Immunsystem des Kindes entwickelt sich mit jedem Krankheitserreger, mit dem es in Kontakt kommt, fortlaufend weiter, und baut so lebenslang ein immunologisches Gedächtnis auf.
Im höheren Lebensalter lässt die Leistungsfähigkeit des Immunsystems nach. Diesen Prozess nennt man Immunoseneszenz. Ältere Menschen sind daher häufig anfälliger für Infektionen.
Wie funktioniert das Immunsystem?
Unser Immunsystem ist ein komplexes System aus Organen, Zellen, Proteinen und chemischen Botenstoffen, das sich in drei verschiedene Abwehrlinien unterteilen lässt.
Physikalische Barrieren: Haut, Schleimhäute, Mikrobiota und Sekrete
Die erste Schutzinstanz des Immunsystems sorgt dafür, dass Keime gar nicht erst in den Körper gelangen. Dabei helfen die Haut, Schleimhäute und eine Reihe von Sekreten.
Eine intakte Haut und gesunde Schleimhäute wirken als physikalische Barrieren. Sekrete wie Speichel oder Schleim helfen, die Mikroorganismen auf der Oberfläche unseres Körpers unschädlich zu machen und abzutransportieren. Die verschiedenen Mikrobiota (von Haut, Darm, Mund usw.) wirken ebenfalls als Schutzschild gegen eindringende Krankheitserreger. Eine Mikrobiota ist die Gesamtheit der Mikroorganismen, die in einem bestimmten Milieu leben.
Angeborene oder natürliche Immunität
Manchmal schaffen es krankheitserregende Viren oder Bakterien dennoch, diese physikalischen Barrieren zu überwinden. Das gelingt ihnen insbesondere an empfindlichen Körperöffnungen wie dem Mund, der Nase und den Atemwegen oder dort, wo ihnen Verletzungen der Haut oder der Schleimhäute den Eintritt erleichtern. Sobald sie in den Körper eingedrungen sind, werden sie mit der angeborenen Immunantwort konfrontiert.
Bei der angeborenen Immunität, die bei der Geburt bereits vorhanden ist, handelt es sich um eine unspezifische zelluläre Reaktion gegen potenziell schädliche Eindringlinge. Unspezifisch bedeutet, dass sich die Abwehr nicht gezielt gegen den jeweiligen Mikroorganismus richtet, sondern alle Arten von Pathogenen auf die gleiche Weise bekämpft. Daran sind verschiedene Sorten von weissen Blutkörperchen beteiligt:
- Wächterzellen, die Krankheitserreger erkennen und die Information über das Vorhandensein und die Art des Pathogens an adaptive Immunzellen weiterleiten – diese führen daraufhin eine spezifischere und effektive Immunantwort durch;
- Phagozyten, die sie zerstören; sowie
- Bestimmte Lymphozyten, die sogenannten «natürlichen Killerzellen» (NK-Zellen), welche Krebszellen und infizierte Zellen abtöten.
Erworbene, adaptive oder spezifische Immunität
Im Laufe des Lebens kommt der Organismus mit einer Vielzahl an Krankheitserregern in Kontakt. Jede durchgemachte Erkrankung trägt dazu bei, ein Immungedächtnis aufzubauen: Der Körper entwickelt bei der erstmaligen Infektion eine speziell auf den jeweiligen Eindringling zugeschnittene Antwort. Daran sind bestimmte weisse Blutkörperchen beteiligt, sogenannte B-Lymphozyten und T-Lymphozyten. B-Lymphozyten bilden Antikörper, die den Erreger unschädlich machen, während T-Lymphozyten infizierte Zellen zerstören. Diese T- und B-Lymphozyten «merken sich» das Antigen, um beim nächsten Kontakt mit demselben Erreger schneller und effizienter reagieren zu können.
Die Bestandteile des Immunsystems im Überblick
Das Immunsystem besteht aus einer komplexen Struktur von Zellen und Organen, die zusammenarbeiten, um den Organismus zu schützen und ihm zu helfen, sich von einer Erkrankung zu erholen.
Zu den Bestandteilen des Immunsystems zählen unter anderem:
- Primäre Abwehr – Dazu gehören u. a. die Haut und Schleimhäute. Die Haut fungiert als erste Barriere, um das Eindringen von Keimen zu verhindern und sie zu eliminieren, bevor sie in den Körper gelangen. Schleimhäute umhüllen die Atem-, Verdauungs-, Harn- und Fortpflanzungswege und helfen beim Abtransport schädlicher Keime. Darüber hinaus verteidigen und zerstören Enzyme in Schweiss, Tränen und Speichel die eindringenden Keime.
- Magen und Darm – Der Magen enthält Säure, die in der Lage ist, einen Grossteil der Bakterien abzutöten, sobald sie in den Körper gelangen. Im Darm befinden sich darüber hinaus nützliche Bakterien, die schädliche Bakterien verdrängen oder an ihrer Vermehrung hindern.
- Milz – Die Milz ist in der Lage, weisse Blutkörperchen zu speichern, die den Körper vor Infektionen schützen.
- Weisse Blutkörperchen – Diese entstehen im Knochenmark und sind Teil des Lymphsystems. Die weissen Blutkörperchen bewegen sich durch das Blut und Gewebe im Körper und suchen nach Bakterien, Pilzen, Parasiten und Viren. Wenn sie auf Krankheitserreger stossen, starten sie einen Immunangriff.
- Lymphknoten – Lymphgefässe transportieren Lymphflüssigkeit zu den Lymphknoten im ganzen Körper. Lymphknoten sind kleine Strukturen, die als Filter für Fremdstoffe dienen. Sie enthalten Immunzellen, die helfen können, Infektionen zu bekämpfen, indem sie Keime angreifen und zerstören, die durch die Lymphflüssigkeit transportiert werden.
- Thymus – Ein kleines Organ im Brustkorb, das zum Lymphsystem gehört und eine bestimmte Art von weissen Blutkörperchen bildet.
- Mandeln und Rachenmandeln – Sie befinden sich in den Rachen- und Nasengängen und fangen Eindringlinge von aussen ab, insbesondere Bakterien und Viren.
- Knochenmark – Das Knochenmark produziert weisse Blutkörperchen, die Infektionen verhindern, rote Blutkörperchen, die Sauerstoff durch den Körper transportieren, und Blutplättchen, die Blutungen kontrollieren, wenn man sich schneidet oder verletzt.

Was schwächt das Immunsystem?
Ein Rückgang der körperlichen Leistungsfähigkeit, ein Mangel an Energie oder häufige kleinere, aber hartnäckige Beschwerden – zeitweise können die Abwehrkräfte geschwächt sein. Typischerweise macht sich das beim Wechsel der Jahreszeiten bemerkbar. Ein geschwächtes Immunsystem manifestiert sich häufig durch eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen. Dies kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden.
Krankheiten und genetische Defekte
Verschiedene Krankheiten und genetische Defekte können das Immunsystem schwächen. Eingeschlossen sind Autoimmunerkrankungen, bei denen das Immunsystem fälschlicherweise gesunde Körperzellen angreift.
Externe Einflüsse
Als Umweltbedingungen bezeichnet man externe Faktoren, welche die Leistungsfähigkeit des Immunsystems beeinflussen können. Darunter fällt beispielsweise der häufige Kontakt mit schädlichen Substanzen. Manchmal verändern auch Medikamente die Intensität, mit der der Körper Infektionen bekämpft. Dann ist eine sorgfältige medizinische Überwachung erforderlich.
Stress
Stress führt zu einer Reaktion bestimmter Hirnregionen, die einen Rückzug weisser Blutkörperchen verursachen können. Das Immunsystem wird geschwächt. Chronischer Stress erhöht die Anfälligkeit für Viren und Bakterien und steigert das Risiko, krank zu werden.
Lebensstil
Ein ungesunder Lebensstil, zu wenig Schlaf, mangelnde körperliche Bewegung sowie der Konsum von Alkohol und Nikotin können ebenfalls das Immunsystem beeinträchtigen. Diese Faktoren tragen zu einer allgemeinen Schwächung der Abwehrkräfte bei.
Das Immunsystem gesund halten
Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, die Abwehrkräfte langfristig leistungsfähig zu halten. Indem wir uns gesunde Gewohnheiten zu eigen machen, können wir das Immunsystem aktiv bei der Bekämpfung von Krankheitserregern unterstützen.
- Gesundes Körpergewicht halten: Über- und Untergewicht durch ausgewogene Ernährung und regelmässige Bewegung vermeiden.
- Alkohol moderat konsumieren: Alkoholkonsum kann das Immunsystem schwächen und die Anfälligkeit für Krankheiten erhöhen.
- Regelmässig Sport treiben: Mindestens 150 Minuten moderate oder 75 Minuten intensive körperliche Aktivität pro Woche. Bewegung kann das Immunsystem unterstützen.
- Stress vermeiden: Techniken zum Stressmanagement wie Meditation, Atemübungen, Yoga oder andere Entspannungsmethoden praktizieren, um das allgemeine Wohlbefinden zu fördern.
- Rauchen aufgeben: Ein Rauchstopp verbessert nicht nur die allgemeine Gesundheit, sondern auch die Funktion des Immunsystems. Unterstützung gibt es durch Beratung oder Nikotinersatztherapie, falls nötig.
- Nährstoffreiche Kost essen: Eine Vielzahl von gesunden Lebensmitteln in die Ernährung integrieren, die reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien sind.
- Genug schlafen: 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht helfen bei der Regeneration und stärken das Immunsystem.
- Impfungen aktuell halten: Den Impfstatus gemäss ärztlicher Empfehlung aktuell halten, um Schutz vor verschiedenen Krankheiten zu gewährleisten.